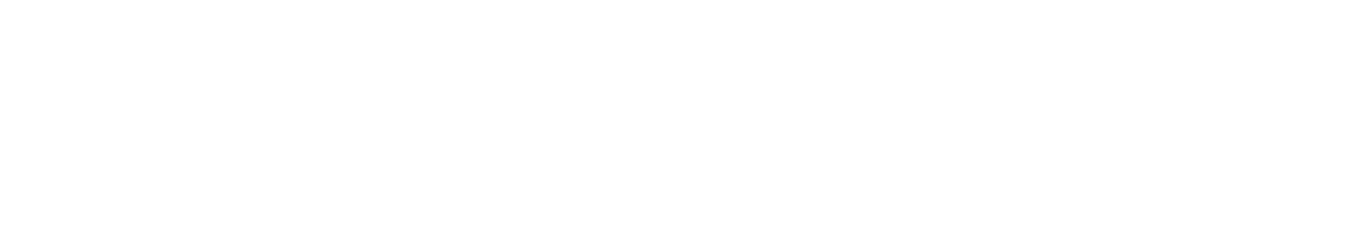Keine so gute Idee
Brauchen Sie noch ein Synästhesie-Modul? Ich hätte eins über. Für lau! Ich war mal wieder zu ungeduldig und hatte es wahrscheinlich falsch verdrahtet. (Um Gebrauchsanweisungen kümmert sich bei uns immer meine Frau, aber die macht ja grad Mutter-Kind in Bad Salzuflen.) Und zuerst hat das Ding auch gut funktioniert: Eine neue, ach was, unzählige neue Dimensionen der Weltwahrnehmung taten sich auf: Bei jeder schwarzen Fläche, die ich sah, war es, als stiege angenehmer Zimtgeruch in meine Nase, bei Rot erklang eine Beethoven-Synfonie. Gelb fühlte sich ledrig an, Blau schmeckte nach Sex On The Beach (dem Cocktail) und Grün war einfach nur Zweiundvierzig – wow! Orange ging noch („Zombie-Action“), aber sobald ich eine zu verstiegene Farbmischung betrachtete, war die Synästhesie nur noch schwer zu ertragen. Türkis weckte eine Empfindung, die an eine Nasenspülung mit heißer, fettiger Rinderkraftbrühe erinnert, Beige klang nach dem Knacken von Fingergelenken und Minzgrün war das alle sieben Sinne triggernde Pendant zu einer lieblos angerührten Pampe aus künstlichem Ananasaroma und Natriumglutamat (welche im Übrigen als E-Zigarren-Liquid unter dem Namen Einhornfurz erhältlich ist). Das war schon grenzwertig, schlimmer aber waren noch die Pastelltöne, denn die riefen in mir das Bild von eingeschlafenen Füßen hervor, Blassrosa sogar von eingeschlafenen haarigen Füßen und Altrosa von eingeschlafenen haarigen Füßen mit lackierten Zehennägeln, und zwar mit unterschiedlich lackierten Nägeln: Beige, Moosgrau, Gelbweiß, Pastell-Aubergine, Dolly-green, Pistazie, Crème, Rosé, Malve und schließlich – Altrosa! Ein Schwall von Zusatzempfindungen wurde von den Zehennägeln in mein Bewusstsein gedrängt, einschließlich noch weiterer Meta-Zehennägel mit noch mehr Synästhesien dritten und höheren Grades – fürchterlich! Ich war in einem Teufelskreis der Selbstreferenz gefangen und muss wohl zitternd und sabbernd über dem Musterbuch gesessen haben, das uns der Maler dagelassen hatte, als mich mich nach zwei Stunden mein Schwager in der Küche fand und mich mit ein paar kräftigen Watschen und einer Nasenspülung mit heißer, fettiger Rinderkraftbrühe aus der katatonischen Agonie erlöste. Das Modul wurde eher unsanft entfernt und liegt seitdem unbenutzt herum. Ich kann die Funktionsfähigkeit nicht garantieren, aber für Bastler könnte es noch von Interesse sein.
11/2018
Grenzen der Bifurkation
Von den hundertsiebenundvierzig Thesen, die Karl der Ketzer vor schlappen hundertsiebenundvierzig Jahren in die Sandsteinumfriedung der Drömelbeker Klosterquelle ritzte, sind seit den letzten Renovierungsarbeiten nur noch gerade mal zweiundsechzig erhalten; davon jedoch sind zwanzig in Rotwelsch und vierzehn in Rätoromanisch verfasst und da man versäumt hatte, den Autor nach einer Übersetzung zu fragen, bevor man ihn der Stadt verwies, verbleiben nur noch achtundzwanzig. Wen wundert es da, dass alle bis auf dreizehn der Sentenzen sich um Wollunterhosen drehen? Von den Verbliebenen sind wiederum acht völliger Nonsens, sodass mir die letztlich überschaubare, nichtsdestoweniger ehrenvolle, Aufgabe übertragen wurde, die restlichen fünf Sätze zu systematisieren. (Man erhoffte sich einen Hinweis auf den Ursprung von Karls unschmeichelhaftem Beinamen, der ihm ja schon zu Lebzeiten verliehen worden war.) Doch schon die Vorarbeiten erwiesen sich als schwierig, insbesondere die Suche nach einer geeigneten Unterkunft in der Nähe des Klosters: Von den zweiundsiebzig Hotels und Pensionen hatten gerade mal schlappe neununddreißig Fassbier im Angebot, die allermeisten jedoch nur süd- oder ostelbische Schlunke, sodass nur zwölf Lokale überhaupt diskutabel waren. Von diesen wiederum beschäftigten fünf entweder ausschließlich Tresenpersonal männlichen Geschlechts oder jenseits der Vierzig. Als ich die übrigen sieben auf WLAN, vegetarisches Essen und Flussblick abklopfte, wurde mir klar: So konnte das sicher kein Meilenstein der Editionsgeschichte werden. (Aber mal im Ernst: Von den als Meilenstein betitelten Editionen sind alle bis auf neun nicht der Rede wert und acht von diesen sind relativ schmucklose Lessing-Ausgaben. Bei der neunten handelt es sich um mein eigenes literarisches Schaffen, aber diese Ausgabe ist streng genommen noch gar nicht veröffentlicht, also nur ein Meilenstein in spe. Ende der Randnotiz.) - Was dann bei der Systematisierung rauskam, war am Ende gar nicht so spektakulär: So hatte sich Karl in den hier verhandelten Kurztexten bloß an einer Handvoll Themen abgearbeitet, in jedem aber gleich an mehreren und niemals in derselben Rehenfolge: Drei der fünf Sinnsprüche lassen sich ex post als Kommentar zur damals üblichen Schaufeldachscheunenbauweise, drei als Lamento über die unzureichenden Lüftungsgewohnheiten der Drömelbeker Mitbürger lesen; drei beinhalteten Kochtipps, vier waren als Abrechnung mit den Exfreundinnen des Ketzers zu verstehen (pikanterweise konnte man eine von ihnen innerhalb der Klostermauern verorten), vier als Loblied auf die Farbe Grün sowie weitere zwei als ironische Spitze gegen den knauserigen Bürgermeister, zwei stellten etwas Ähnliches wie Bauernregeln dar, jedoch nicht auf Ackerbau, sondern auf das damals im Werden befindliche Zwiebelschleifergewerbe bezogen. Keine der Thesen umfasste wenger als drei Zeilen oder siebzehn Silben, alle jedoch bis auf eine waren gekennzeichnet durch ein protomodernes Heringsverständnis und ließen die Neigung des Verfassers erkennen, am Mittwochmorgen lange auszuschlafen. Irgendwie menschlich, oder?
10/2019
Noch einmal Zibagger
Das Leben ist wie ein Uhrwerk, der Mensch wie dunkle Gelatine und mein Arsch wie ein Stück Holz. Aber: Keiner wird jemals erfahren, warum die Zeit als Schneckengehäuse der Materie nichts taugt und der Geist bestenfalls ein schwacher Abglanz von etwas ist, das schon als Extrigeum solipensis aus allen seriösen Quellen getilgt wurde. Jegliche Systematik und Ordnungsversuche überstehen kaum die kleinste Lachgasverpuffung, während die Begriffsunschärfe, auf sich selbst angewandt, uns einen Knoten ins Hinterhirn zaubert. Das einzige, dessen wir uns auch nur ansatzweise sicher sein können, hat keine Bezeichnung, zumindest nicht in irgendeiner Sprache, die von irgendeinem zivilisierten Individuum in den letzten zwanzig Dekaden jemals aktiv benutzt wurde, jedenfalls nicht vor der Polizeistunde. Aber es lässt sich immerhin eingrenzen, denn es nimmt bisweilen eine blassgrünliche Färbung an, hat auf der nördlichen Hemisphäre eine leichte Vanillenote und manifestiert sich an Wochentagen ohne h als ein Tier, das quakt, aber prinzipiell Fell hätte, wäre es nicht eigentlich eine Steinfigur (schon arg lädiert und angeknackst und mindestens einmal zusammengeleimt mit den eingedickten Tränen, die um verloren gegangene Authentizitätskonzepte vergossen wurden; Quaken tut es übrigens trotzdem); in der übrigen Zeit sieht es aus wie ein langweiliger Quader mit fraktaler Oberfläche, über die nicht einmal Gärtner Pötschke etwas gereimt hat. Gerade kommt die Meldung rein dass die Eleven des siebten Zirkels auf der Rudolf-Steiner-Schule in Mönkhagen eben jenen Quader mehr oder minder erfolgreich mit Salzteig modelliert haben – man sollte aber nicht außer Acht lassen, dass in derartigen Bildungseinrichtungen Quader nicht selten auch mal Tierform annehmen können, aber das nur am Rande, man will ja die Lebensleistung dieser jungen Menschen nicht schon im Vorfelde diskreditieren. Sie halten das mal wieder für eine maßlose Übertreibung, oder? Na, dann schauen Sie sich mal meinen Schreibtisch an, dann wissen Sie, was ich meine.
09/2019
Wir beschwören einen Dämon, wenn sie kommt
Unser Lautmalerstammtisch hatte es bis in die Lokalpresse geschafft. Die monatlichen Treffen im RaRaRasputin (mit Sojageschnetzeltem und Starkbier) waren stets gekrönt von mindestens fünfundsiebzig Strophen „Tante aus Marokko“ und zogen manchmal sogar mehr Neugierige an, als uns lieb war. Als Hüter der Tante war ich gewissermaßen der Zeremonienmeister unserer Treffen, da ich alle vier Wochen mindestens eine neue Geräuschquelle nebst onomatopoetischem Pendant zu präsentieren hatte. Mit dieser Sonderstellung ausgestattet, war ich nicht verwundert, als sich auf einmal der Briefmarkenhändler Isaak Weinberg neben mich setzte und mir ein großes Dinkelsbühler Dunkel auf den Tisch stellte. Der Mann hatte gut recherchiert, aber er war mir auch kein Unbekannter: Er entstammte einem uralten böhmischen Rabbinergeschlecht und lebte seit bald zehn Jahren bei uns im Norden in einer Villa am Stadtrand. Seine beiden entzückenden Töcher Sarah und Judith waren schon lange vor uns Lieblinge der örtlichen Journaille, natürlich in anderen Titeln als der Stammtisch. Herr Weinberg gab sich als praktizierender Anhänger der Akustischen Kabbala zu erkennen. Das ist eine mystische Strömung, die auf der Suche nach dem ultimativen Namen des Höchsten Wesens nicht das hebräische, sondern das phonetische Alphabet benutzt, und gelegentlich auch versucht, tote Materie mit Geräuschen statt mit Zaubersprüchen zu beleben und zu beherrschen. (Da war mal was mit einem Pfefferkuchenmann in Prien, glaube ich, aber so ganz kriege ich die Geschichte nicht mehr zusammen.) Für deren obskure wie okkulte Forschungen sollte ich neue Geräusche erfinden und transkribieren, wofür mir Weinberg als Entlohnung einen eigenen You-Tube-Kanal sowie eine Einladung zum Kreispresseball offerierte. Ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte, war doch schließlich das Erscheinen der gesamten hiesigen Weinberg-Dynastie angekündigt, auch der jungen Damen, deren Kontaktdaten in meinem Adressbuch noch fehlten. Gesagt, getan. Gewissenhaft experimentierte ich mit einem von Bord eines Segelschiffs auf den Landesteg geworfenen Lederkoffer (schtlaummp – keine Materiebelebung), einer ungeölten Schranktür, in deren Scharniere ich zwei Tüten Bärlappsamen hineingeniest hatte (fnöörk – dito) sowie einem malayischen Streifenhörnchen unter Starkstom (brrzzs – gegenteiliger Effekt). Derartige Fehlschläge oder sagen wir mal, Nebengeräusche, die keine magische Wirkung zeigten, konnte ich natürlich nach Belieben für unseren Kneipengesang verwenden, also arbeitete ich fröhlich weiter. Ich versuchte es mit dem Geräusch, das entsteht, wenn man einen halbe Tasse Sesamöl, einen Schubser Schmierseife sowie vierzig Gramm kristallines Natriumhydroxid im Badezimmerabfluss versenkt. Aus nachvollziehbaren Gründen verzichte ich hier auf die exakte Transkription des annähernd plopp-ähnlichen Geräuschs, denn tatsächlich schob sich etwas, von grünlichen Dämpfen begleitet, aus den Tiefen des Rohrsystems hoch in meine Dusche und es klang seinerseits sehr schlecht gelaunt und überaus hungrig. Ich ergriff die Flucht ins Wohnzimmer, wurde aber von der vielgliedrigen und formlos quietschenden und wabbelnden Entität verfolgt. Ich warf dem Wesen Haushaltsgegenstände und Möbelstücke in den Weg und versuchte mich auf die Fensterbank zu retten, da hörte ich, wie die Wohnungstür aufgebrochen wurde. Statt der Kavallerie erschien aber nur die Frau mit den Pistazienhaaren (die aus der Wohnug unter mir), die sich über den Lärm beschweren wollte und sich nun in einem Anfall von Wahnsinn in meinen Unterschenkel verbiss – es war furchtbar! Dann endlich nahte die Rettung in Form des Kabbalisten. Mit dem Ton einer doppelläufigen Knotenposause, ganz ähnlich dem Klang der oben erwähnte Schranktür, trieb er das Ding zurück ins Bad, die Nachbarin wurde mit einer schweren Bratpfanne zur Räson gebracht. Ich atmete auf. Weinberg entband mich von seinem Auftrag und zog leider auch die Einladung zum Ball zurück. Aber drei neue Strophen, das konnte sich doch schon mal hören lassen. Beim Aufräumen sang ich schon wieder fröhlich vor mich hin und freute mich auf den nächsten Stammtisch. Ja, ja, yippie, yippie, yeah!
12/2018
Länger als breit
Die Schwiegermutter hatte ihren Besuch angekündigt. Während meine Gattin nicht nur die Küche, sondern auch eben mal kurz Stube, Bad, Flur und Keller auf Vordermann brachte, begann ich eher lustlos die obere meiner drei Schreibtischschubladen auszumisten. Neben meinem Skizzenblock, fünf gequetschten Bierdosen, einer Unmenge geklauter Kugelschreiber und dem obligatorischen Rest einer Croque-Mahlzeit (mit Linse-Haselnuss-Bratling) fiel mir eine Dynamitstange in die Hände, unbenutzt, versteht sich, aber mit Lunte. (Das Ding war, wie auch die Bierdosen, aus dem vorletzten Angelurlaub in den Spreewaldsümpfen übrig geblieben, wo Fiete, Groggy und meine Wenigkeit versucht hatten, auf Brasse zu gehen, aber das ist eine andere Geschichte.) Was also tun? Da ich keine Lust hatte, den Kampfmittelräumdienst durch unsere in solchen Putzphasen wirklich nicht präsentable Wohnung zu führen, packte ich den Sprengkörper in Watte und fuhr damit zu Efraim „Big F“ Scheuermann, der in einer Scheune am Ortsrand ein Museum der abgelegten Phallussymbole betreibt. Big F pustete gerade die Holzwolle von der frisch eingetroffenen Jadestatuette eines ovomaltekischen Wurzelgotts und gewährte mir und meinem Fund nur halbe Aufmerksamkeit. Oh, Dynamit, brummelte er, ohne die Kippe aus dem Mund zu nehmen, leg‘s zu den anderen in die Kiste da hinten, ja? Zuerst war ich ein wenig gekränkt – etwas mehr Dankbarkeit hatte ich schon erwartet – aber dann musste ich einsehen, dass so ziemlich alles, was auch nur ansatzweise penisähnliche Proportionen hatte, bereits in mehrfacher Ausführung vorhanden war, von elektrischen Zahnbürsten und Blumenvasen über unzerquetschte Bierdosen, Regenschirme und Spielzeugeisenbahnen bis hin zu… Da erschien meine Frau mit ihrer Mutter und zwei Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes im Museum. Sie alle hatten Gummihandschuhe und Gasmasken übergezogen und lieferten den Croque-Rest aus meinem Arbeitszimmer ab. Der erfreute Big F schon mehr und als Dankeschön durften wir uns etwas aus dem Mitmach-Raum aussuchen. Schwiegermutti lud den Kofferraum des Volvo voll und meine Frau wählte zielsicher eine skandinavische Stehlampe fürs Wohnzimmer. Ich dagegen ließ nur ein paar Kulis mitgehen, die passten gerade noch ins Handschuhfach.
10/2018
Trauma-Novelle
Es hatte angefangen wie immer: Ich hatte die neue Haarfarbe meiner Freundin nicht mitbekommen, sie hatte mich abserviert, ich mich nach allen Regeln der Kunst besoffen und dem Abteilungsleiter im falschen Moment auf den Anzug gekotzt, war Job und Wohnung losgeworden und musste mit einem mentalen Kraftakt meinem Leben eine neue Richtung geben. So weit, so gut. Diesmal versuchte ich es als Musikant, da hatte ich zumindest keine nachtragenden Vorgesetzten zu befürchten. Ich entsann mich meiner Jugendzeit, in der ich so manche Stunde Trockengeigenunterricht auf mich nehmen musste, und da ich mich nicht als völlig untalentiert herausgestellt hatte, wollte ich an dieser Stelle wieder anknüpfen. Jedoch war ich noch nicht über „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ hinausgekommen, da vermittelte mich mein völlig vertorfter Agent ausgerechnet an ein Nassbassensemble, das gerade irgendwo in Südostasien tourte, und ehe ich mich‘s versah, hatte ich einen Knebelvertrag unterzeichnet, der mich zwang, dem Quartett Richtung Hanoi nachzufliegen. Die dicke Berta begrüßte mich am Flughafen, meine Ankunft war ihr und den anderen Ensemblemitgliedern höchst willkommen. Völlig untypisch für diese Region, hatte es seit knapp vier Stunden nicht mehr geregnet und die Nassbässe versagten ihren Dienst. Allein mit meiner Trockengeige konnte ich als erster Europäer übehaupt vor dem usbekischen Botschafter und etlichen Abgeordneten des Zentralkommitees auftreten, um der Einweihung einer frisch installierten Abhöranlage einen feierlichen Rahmen zu verleihen. Ich sag euch, da geht einem der Arsch ganz schön auf Grundeis mit all den kritsch dreinblickenden Kaderfritzen und natürlich kam es zum Eklat, entweder wegen meines eingeschränkten Repertoires oder weil ich beim Fiedeln immer mitsummte, was in der vietnamesischen Kultur extrem verpönt ist. Mit lautem Geheul stürzten sich die Parteibonzen auf mich und meine Kollegen, und nur dem beherzten Eingreifen des Botschafters ist es zu verdanken, dass wir nicht an Ort und Stelle in Stücke gerissen wurden. Mit unseren Instrumenten prügelten wir uns buchstäblich den Weg frei, wobei sich Bassgeigen als außerordentlich schlagkräftig herausstellten. War das ein Gemetzel! Natürlich waren wir chancenlos, aber wir verkauften uns so teuer wie möglich und schlugen uns bis zum Ufer des Roten Flusses durch, wo mich Berta in ihren Basskoffer steckte und ins Wasser warf. Von ihr hab ich seitdem nichts mehr gehört; ich selbst wurde erst in Singapur wieder an Land gespült. Das gab noch mal acht Monate Straflager wegen Strandverschmutzung, kein Zuckerschlecken, sag ich euch, aber ein Pappenstiel gegen meine Zeit in Vietnam. Da kenn ich mich aus.
07/2019